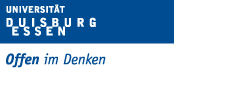Physik
Fast selbstverständlich wird von vielen der morgendliche Stau im Berufsverkehr als unvermeidbar hingenommen. Dass es auch anders geht, zeigt ein Beispiel aus dem Tierreich: Auch Ameisen bilden Straßen und nutzen diese beispielsweise, um Nahrung zu ihrem Nest zu transportieren. Man beobachtet aber auf diesen Straßen auch bei hohem „Verkehrsaufkommen“ keine Staus – im Gegenteil, überraschenderweise bewegen sich Ameisen mit zunehmendem
„Verkehr“ teilweise sogar noch schneller voran, weil sie miteinander kommunizieren.
Künftig werden Fahrzeuge über spezielle WLAN-Funknetze (Reichweite ca. 300 m) Informationen wie zum Beispiel Unfallmeldungen und Verkehrsinformationen austauschen können. In der Arbeitsgruppe von Prof. Michael Schreckenberg wird im Rahmen des Forschungsprojektes „Next Generation Car-2-X Communication“ untersucht, wie sich die Schwarmintelligenz der Ameisen auf den Straßenverkehr übertragen lässt, um mittels Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation den Verkehrsfluss zu steigern. Computersimulationen
mit Zellularautomaten zeigen, dass schon 5 % kommunizierender Fahrzeuge im Stoßverkehr genügen, um die Reisezeit aller Verkehrsteilnehmer signifikant zu verbessern. Ist jedes vierte Fahrzeug mit Funk ausgestattet, können viele Staus fast vollständig verhindert werden.
In der Nanowelt gelten andere Gesetze als in der makroskopischen Welt. Wie sich das auf die Funktionsweise von extrem kleinen elektronischen (Halbleiter-) Systemen auswirkt und wie die beobachteten Phänomene genutzt werden können, wird in der Arbeitsgruppe von Prof. Axel Lorke untersucht. Ein Beispiel: In „großen“ Drähten bewegt sich elektrischer Strom fast so wie eine geladene Flüssigkeit. In Halbleiter-Nanostrukturen ist jedoch zu beobachten, dass sich einzelne Elektronen ballistisch, wie frei fliegende geladene Partikel, verhalten. Dies macht es möglich, durch eine geeignete Form der Nanostruktur die Bewegung der Elektronen zu lenken und so elektronische Bauelemente – beispielsweise Gleichrichter oder Dioden – herzustellen. Auch die Quanteneigenschaften der Elektronen spielen auf der Nanometer-Skala eine große Rolle, und es ist möglich, kleine Halbleiter-Inseln herzustellen, in denen sich einzelne Elektronen nach den Gesetzen verhalten, die wir aus der Atomphysik kennen. Nur bieten diese „künstlichen Atome“ viel mehr Flexibilität. Sie können elektrisch kontaktiert werden und ihre Elektronenzahl kann durch eine elektrische Spannung eingestellt werden. Auch ist es erstmals gelungen, die Wellenfunktionen der Elektronen sichtbar zu machen und diese gezielt mit einem angelegten Magnetfeld zu mischen, so dass neue Quantenzustände entstehen. Ziel dieser Untersuchungen ist es,
Informationsspeicherung mit einzelnen Elektronen zu erzielen und mit Hilfe der Quantenmechanik völlig neue Konzepte der Informationsverarbeitung zu realisieren („Quantum Computing“).
Ein Durchbruch bei der Herstellung magnetischer Materialien mit außergewöhnlich hohen magnetischen Momenten bei Raumtemperatur gelang in der Arbeitsgruppe von Prof. Heiko Wende. Solche Materialien werden heutzutage für zahlreiche Anwendungen wie zum Beispiel als Schreibköpfe für Computer-Festplatten und Elektromotoren gesucht. Der zu schlagende Rekord wurde seit 75 Jahren von einer Fe-Co-Legierung mit einem magnetischen Moment von ca. 2.45 µB pro Atom gehalten. Zwar besitzen
Selten-Erd-Metalle aus der Gruppe der Lanthanide wie Gd weitaus größere magnetische Momente, allerdings weisen sie bei Raumtemperatur keine ferromagnetische Ordnung auf. Kombiniert man diese mit Ferromagneten wie zum Beispiel Fe, so wird die Ordnungstemperatur des Lanthanids durch die Kopplung erhöht. Allerdings ist die Kopplung zwischen den verschiedenen Metallen antiferromagnetisch, was die Nettomagnetisierung drastisch reduziert. Ein Ausweg aus diesem Dilemma wurde in der Theorie-Gruppe von Prof. Eriksson (Uppsala University) vorhergesagt und experimentell in der AG Wende verifiziert: Durch Hinzufügen einer Zwischenschicht aus Cr kann eine effektive ferromagnetische Kopplung zwischen Fe und Gd erzwungen werden. Durch temperaturabhängige Untersuchungen wurden magnetische Momente um 5 µB in Gd bei Raumtemperatur in der Grenzfläche bestimmt, die tatsächlich ferromagnetisch an die Fe-Momente gekoppelt sind.
In der Arbeitsgruppe von Prof. Marika Schleberger widmet man sich unter anderem der Untersuchung von Graphen. Graphen besteht aus einer einzigen Lage von Kohlenstoffatomen und hat ganz ungewöhnliche mechanische und elektronische Eigenschaften. So ungewöhnlich, dass die Entdecker Andre Geim und Konstantin Novoselov im Oktober 2010 für ihre Experimente an Graphen den Nobelpreis für Physik erhielten. Die AG Schleberger interessiert sich vor allem dafür, wie das Material unter elektronischer Anregung reagiert. Eine der Besonderheiten von Graphen ist seine extrem hohe elektrische Leitfähigkeit, die eigentlich dazu führen sollte, dass auch intensive elektronische Anregungen keine permanenten Materialveränderungen herbeiführen. Für viele Anwendungen wäre jedoch beispielsweise die kontrollierte Erzeugung von eindimensionalen Defekten in dem ansonsten perfekten hexagonalen Gitter wünschenswert oder sogar erforderlich. In einem ersten Experiment wurden Graphen-Proben am Schwerionenbeschleuniger in Caen, Frankreich, mit 100 MeV-Ionen bestrahlt und danach mit einem Rasterkraftmikroskop untersucht. Es zeigte sich, dass die Graphen-Proben nach der Bestrahlung charakteristische Veränderungen aufwiesen, die aber nur zum Teil durch den direkten Energieeintrag in das elektronische System des Graphens verursacht wurden. Jetzt gilt es, die experimentellen Bedingungen möglichst so abzuändern, dass in das Graphen-Gitter zwar eindimensionale Defekte eingebaut werden, der Graphenfilm aber dabei nicht mehr zerrissen wird. Für diesen Zweck wird ein neues Experiment am Schwerionenbeschleuniger der GSI in Darmstadt aufgebaut, das vom BMBF finanziert wird und 2011 anlaufen soll.
In der Arbeitsgruppe von Prof. Andreas Wucher wird das Billardspiel auf atomarer Größenskala untersucht. Dabei werden Atome beziehungsweise Ionen auf eine Festkörperoberfläche geschossen und lösen dort eine Kette von Stoßprozessen aus, in Folge derer unter anderem Teilchen (Atome und Moleküle) von der Oberfläche wegfliegen. Dieser als „Ionenzerstäubung“ oder „Sputtering“ bezeichnete Prozess wird technisch auf vielfältige Weise ausgenutzt, in dem das zerstäubte Material entweder zur Abscheidung dünner Schichten oder aber durch massenspektrometrische Analyse zur Bestimmung der Oberflächenzusammensetzung benutzt wird. Durch Verwendung eines feinfokussierten Ionenstrahls lassen sich auf diese Weise hochaufgelöste chemische Abbildungen der
Oberfläche gewinnen. Setzt man den Beschuss
für eine gewisse Zeit fort, so wird die Oberfläche abgetragen. Analysiert man den Boden eines
solcherart erodierten Kraters als Funktion der Kratertiefe, dann erhält man eine hochaufgelöste dreidimensionale Abbildung der chemischen
Zusammensetzung des untersuchten Festkörpers im oberflächennahen Bereich. In Kooperation
mit einer Arbeitsgruppe an der Pennsylvania State University konnte vor kurzem gezeigt werden, dass eine solche 3D-Analytik auch für molekulare Schichten erfolgreich durchgeführt werden kann, wenn zum Beschuss der Oberfläche zum Beispiel C60 Cluster anstelle atomarer Projektile verwendet werden.
In der Grundlagenforschung werden vor allem die Schritte und Wege untersucht, auf denen die durch das Projektil in die Oberfläche eingetragene kinetische Energie im Festkörper dissipiert wird. Durch die Kombination experimenteller Arbeiten und Computersimulationen konnte gezeigt werden, dass ein großer Teil dieser Energie unmittelbar nach dem Einschlag – im Gegensatz zum Billard – zunächst ins Elektronensystem des Festkörpers transferiert wird und dort für starke lokale elektronische Anregungen sorgt. Als Folge emittiert der Festkörper Elektronen und Teilchen in angeregten sowie zum Teil ionisierten Zuständen, wobei die Bildung der zerstäubten „Sekundärionen“ extrem wichtig für die massenspektrometrische Oberflächenanalytik ist.
Eine wichtige Forschungslücke hat das Team von Prof. Uwe Bovensiepen in Kooperation mit Partnern aus San Sebastian in Spanien geschlossen. Ihnen gelang es, die rechnerischen Ergebnisse zur Lebensdauer von Quasiteilchen an Grenzflächen zwischen Halbleiter und Metall experimentell zu bestätigen. Wichtig ist dies für die Herstellung immer kleinerer Strukturen, etwa in Mikroprozessoren.
Als Quasiteilchen werden Elektronen im Zustand der energetischen Wechselwirkung mit anderen, angekoppelten, Elektronen bezeichnet. Lenkt man zum Beispiel einen Laserpuls auf die Oberfläche eines hauchdünnen Bleifilms, so werden die Elektronen an der Oberfläche des Bleifilms angeregt und in eine höhere Schwingungsfrequenz versetzt. Ist das Substrat, auf das der hauchdünne Bleifilm aufgebracht ist, ein leitfähiges, wie zum Beispiel Kupfer, wandern Elektronen in dieses benachbarte Substrat ab. Bildlich gesprochen: Sie lösen sich aus dem Verband der Elektronen im Blei, bevor sie von dem Quasiteilchen überhaupt mit ihrem Anteil an der zu verteilenden Energie bedacht werden konnten. Das Einsickern von Elektronen in ein benachbartes Substrat verfälscht also das Ergebnis, es verkürzt die beobachtete Lebensdauer des Quasiteilchens.
Die Forscher haben nun ein Verfahren gefunden, dieses Abwandern zu verhindern. Das gelingt mit halbleitenden Substraten, die unterhalb einer bestimmten Temperatur nicht mehr leiten. Nimmt man statt des leitfähigen Materials ein Halbleitermaterial, wie Silizium als Substrat, lässt sich ein „Energiefenster“ schaffen, innerhalb dessen sich die Theorie zur Lebensdauer von Quasiteilchen experimentell bestätigt.
Die Arbeitsgruppe von Prof. Hermann Nienhaus ist auf der Spur heißer Elektronen, die durch Reaktionen mit Gasteilchen in Metalloberflächen entstehen. Ein Teil der freigesetzten Reaktionsenergie wird nicht direkt in Wärme umgewandelt, sondern auf die Elektronen im Metall übertragen. Diese elektronische Anregung ist von extrem kurzer Dauer und währt nur wenige 10 fs (1 fs = ein Milliardstel einer Mikrosekunde). Für den schwierigen Nachweis wurde eine Methode mit speziellen, selbst hergestellten, elektronischen Bauelementen wie zum Beispiel Schottky-Dioden mit nm-dicken Metallschichten entwickelt. In den Bauelementen entsteht ein elektrischer Strom (Chemostrom) während der Oberflächenreaktion. Es ist nun mit dieser Methode erstmals gelungen, auch bei der Homoepitaxie, das heißt bei der Deposition von Mg-Atomen auf einem Mg-Film, heiße Ladungsträger nachzuweisen. Das überraschende Ergebnis erweitert die Vorstellungen von den dynamischen Prozessen bei der Metallepitaxie erheblich. Die aktuelle Forschung beleuchtet auch die praktische Anwendung der Chemoströme: Sie lassen sich für die Gassensorik und Reaktionskontrolle auf kleinstem Raum oder sogar zur direkten Umwandlung von chemischer in elektrische Energie nutzen.
Die Arbeiten der Gruppe von Prof. Gerhard Wurm beschäftigen sich auf unkonventionelle Weise – im Laborexperiment auf der Erde und unter Schwerelosigkeit – mit der Planetenentstehung und der Oberfläche und Atmosphäre des Mars. Fragen, die detailliert untersucht werden, sind unter anderem, wie aus Mikrometerpartikeln größere Körper wachsen. Verschiedene Mechanismen wie Stöße von mm/s bis 200 km/h, die Erosion von Oberflächen durch Wind bei geringem Gasdruck oder die Erosion durch Sonneneinstrahlung werden untersucht. Letzterer Prozess wurde eher durch Zufall entdeckt, erwies sich
jedoch als außerordentlich bedeutend, da er es erlaubt, Partikel im Labor schweben zu lassen, und sowohl zum ungelösten Problem des Staubtransports auf dem Mars als auch zum Recycling von Material im frühen Sonnensystem beiträgt. Der Effekt ist stark von der Gravitation abhängig. Dies wurde auf Parabelflügen gezeigt. Der Transport von Partikeln durch Sonnenstrahlung in protoplanetaren Scheiben wurde ebenfalls unter Mikrogravitation untersucht und an extraterrestrischem Material in Fallturmexperimenten quantifiziert. In der Gesamtheit tragen die untersuchten Teilprozesse dazu bei, besser oder überhaupt zu verstehen, wie aus einzelnen Staub- oder Eispartikeln in wenigen Millionen Jahren Planeten wie die Erde oder Jupiter werden.